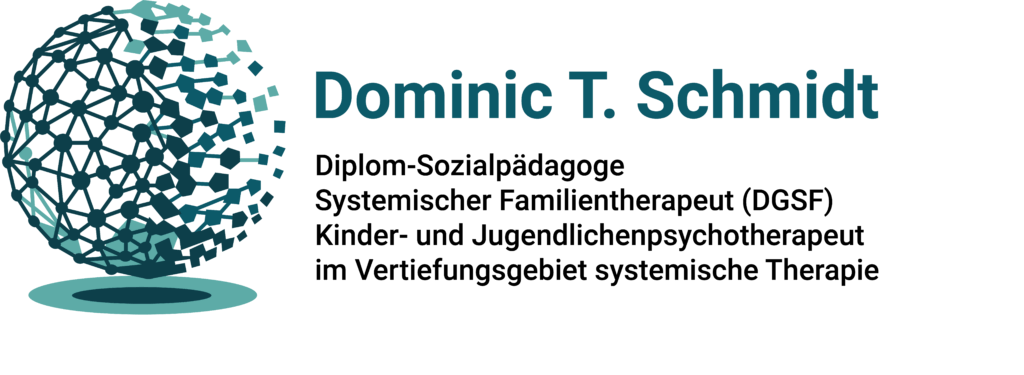
Praxis für systemische Therapie (KJP),
Paartherapie & Coaching
Gesetzlich Versicherte Privat Versicherte Beihilfeberechtigte Versicherte Selbstzahlende
Termine nur nach Vereinbarung!
Liebe Interessierte und Klient*innen,
im Zeitraum vom 05.06.2025 bis zum einschließlich 09.06.2025 bin ich urlaubsbedingt leider nicht in der Praxis anzutreffen oder telefonisch zu erreichen. Bitte melden Sie sich gerne per Mail für Ihre Anliegen. Ich werde mich nach meinem Urlaub schnellstmöglich bei Ihnen zurück melden. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.
Herzlich Willkommen
auf meiner Praxishomepage.
Ich möchte Ihnen auf den folgenden Seiten einen kleinen Überblick zu meiner (beruflichen) Person und Berufsprofession, sowie meinen Leistungen geben. Bei all dem Wirr-Warr rund um Therapien und den verschiedenen Verfahrensgebieten erkläre ich Ihnen in einer Kurzfassung die wichtigsten Themen und häufigsten Fragen und würde mich freuen, wenn Sie sich bei Interesse an einer systemischen- Psychotherapie für Kinder- und Jugendliche, Familientherapie und Paartherapie oder einem Coaching an mich wenden und wir ein Kennenlerngespräch vereinbaren.
UPDATE-NEWS!
Aus der Privatpraxis wurde die Praxis für systemische Therapie (KJP), Paartherapie & Coaching!
Seit dem 01.03.2025 habe ich eine kassenärztliche Zulassung und kann nun auch gesetzlich versicherte Patient*innen abrechnen.
Über mich
Dominic Tobias Schmidt
Ursprünglich in Niedersachsen bei Hannover aufgewachsen, hat mich mein beruflicher Lebensweg nach Abschluss eines Fachabiturs für Gestaltung im Jahr 2007 zur Überbrückung meiner Bewerbungsphase für ein Produktdesignstudium zuerst in ein Demenzheim in Hannover geführt. Nach einem dortigem freiwilligem sozialem Jahr (FSJ) und den, für mich, sehr prägsamen Erfahrungen, habe ich meine beruflichen Lebensziele, die bis dahin noch ausschließlich im Bereich Design angesiedelt waren, komplett verändert und hatte klar:
„Ich will Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt für Familien werden.“
Meine erste Anlaufstelle hieraufhin zog mich 2009 nach Aachen an die niederländische Grenze.
In der an Deutschland angrenzenden, niederländischen Stadt Sittard habe ich mein 4,5 jähriges Bachelor-Studium zum Sozialpädagogen von 2009 – 2014 an der Hogeschool Zuyd absolviert und erlangte erst den Bachelor of Social Work und kurz darauf die staatliche Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland als Diplom-Sozialpädagoge.
Als parallellaufenden Studiengang habe ich während des Sozialpädagogikstudiums auch noch eine weiterbildende Berufsausbildung als „Social Worker in Mental Healthcare(ENG) /Geestelijk Gezondheids-Agoog(NL)) abgeschlossen, bei der die Psychopathologie, Psychologie und Sozialtherapie, sowie tiergestützte Therapie im Fokus standen.
2014 begann ich nahtlos an das Studium anknüpfend die Ausbildung zum Psychotherapeuten für Kinder- und Jugendliche im Vertiefungsgebiet systemische Therapie am ifs-Essen.
Noch in Aachen sammelte ich direkt einen Monat nach Studienabschluss mein erstes halbes Jahr Berufserfahrung in einer Praxis für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie im Vertiefungsgebiet Verhaltenstherapie, systemischer Familientherapie, Paartherapie und Sexualtherapie und lernte den ersten Einstieg in die psychotherapeutische, familientherapeutische- und paartherapeutische- Berufspraxis kennen.
Anfang 2015 zog ich von Aachen nach Essen ins Ruhrgebiet und begann dort mein Klinikjahr in den Kliniken Essen Süd in Essen Werden in der dortigen Tagesklinik, sowie der dortigen Ambulanz.
Meine praktische Ausbildung setzte ich nach dieser sehr intensiven Zeit in einer Sozialpsychiatrie in Duisburg Duissern fort und arbeitete dort von 2016 bis 2020 bereits weitestgehend selbstständig unter Supervision.
2017 erhielt ich durch den Abschluss der Zwischenprüfung in systemischer Therapie und entsprechender Leistungsnachweise die Zertifizierung als systemischer Familientherapeut nach DGSF Standards.
Im Oktober 2021 erhielt ich die Auszeichnung zum staatlich anerkannten Psychotherapeuten für Kinder- und Jugendliche, im März 2022 die Staatliche Approbation. Die familientherapeutische Arbeit setzte ich nach Berufsabschluss fort. Von 2022 bis 2024 arbeitete ich in einem medizinischem Versorgungszentrum in Essen Haarzopf als angestellter Psychotherapeut.
Seit November 2023 befinde ich mich parallel in eigener Praxis in Essen Rüttenscheid, bin jedoch weiterhin als aufsuchender Familientherapeut tätig. Auf Grund der intensiven und auch immer wieder notwendigen Arbeit mit (Eltern-)Paaren habe ich zusätzlich den Schwerpunkt Paartherapie in mein Behandlungsrepertoire mit aufgenommen.

Systemische Therapie
Teil der psychotherapeutischen Versorgung
Eine kurze Erklärung:
Die systemische Therapie (ST) ist ein Vertiefungsgebiet der Psychotherapie und seit dem 22. November 2019 offiziell eines der vier anerkannten Richtlinienverfahren, zu denen auch die Psychoanalyse (PA), Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie (TP) und Verhaltenstherapie (VT) gehören. Sie ist das letzte, durch den gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) zugelassene Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen, deren Wirksamkeit, zur Reduktion psychischer Störungen, durch eine mehrjährige Prüfung bestätigt wurde. Dabei teilt sich die Psychotherapie in zwei grundlegende Behandlungsbereiche. Den Bereich für die Erwachsenenpsychotherapie (psychologische Psychotherapie) und den Bereich für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.
Systemische Therapie ist seit 2019 sozialrechtlich für den Behandlungsbereich der Erwachsenen anerkannt und darf seitdem auch durch psychologische Psychotherapeut*innen von den gesetzlichen Krankenkassen als Richtlinienverfahren abgerechnet werden.
Die systemische Therapie für Kinder- und Jugendliche befand sich seit dem 19.08.2020 in der Prüfungsphase zur sozialrechtlichen Anerkennung und ist seit dem 18.01.2024 ebenfalls sozialrechtlich anerkannt. Seit dem 01.07.2024 ist systemische Therapie als Psychotherapie für Kinder- und Jugendliche nun offiziell implementiert und kann durch alle Krankenkassen, sowohl den gesetzlichen als auch privaten, sowie Kostenbeihilfestellen abgerechnet werden.
Insbesondere in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sind Kinder- und Jugendliche noch sehr von Erwachsenen und dem Umfeld in dem sie leben abhängig, so dass die Interaktionsdynamik zwischen beispielsweise Großeltern, Eltern und Kindern eine viel größere Rolle spielt, als bei Erwachsenen, die sich ihr Umfeld bis zu einem gewissen Grad noch selbst aussuchen können. Die Mitarbeit der Personen dieses Umfeldes wird hierdurch gerade in dieser Arbeit noch viel wichtiger als im Erwachsenenbereich. Die systemische Therapie im Kinder- und Jugendlichenbereich sieht daher in der Regel immer auch eine möglichst sinnvolle Einbeziehung des nahen Umfeldes der zu behandelnden Patient*innen vor, so dass zu den Terminen nicht nur die Kinder- und Jugendlichen und/oder jungen Erwachsenen selbst erscheinen, sondern nach Möglichkeit auch immer wieder die erweiterten Bezugssysteme (nahestehende Personen wie Familienmitglieder, Freunde, etc.) mit in die Therapie einbezogen und Teil der Veränderung werden.
Bei einer Psychotherapie im Kinder- und Jugend- sowie jungem Erwachsenenbereich wird i.d.R. vom 4. Lebensjahr bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres (21. Geburtstag) behandelt, wobei eine Therapie mit Familien mit jüngeren Kindern auch möglich ist, hierbei jedoch eher elternzentriert gearbeitet wird. Nach den neuesten Richtlinien, darf eine Therapie, die vor der Vollendung des 21. Lebensjahres begonnen wurde auch nach Abschluss dieses noch bei den selben Psychotherapeut*innen beendet werden. Ab dem 18. Lebensjahr dürfen Betroffene selbst entscheiden, ob sie sich noch durch Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen oder direkt durch psychologische Psychotherapeut*innen für Erwachsene behandeln lassen wollen.
Alle Richtlinienverfahren der Psychotherapievertiefungsgebiete (ST, PA, TP und VT) sind sowohl für Kinder- und Jugendliche, sowie Erwachsene zur Behandlung psychischer Störungen zugelassen.
Wie oben bereits beschrieben gilt die systemische Therapie als Teil der Psychotherapie und ist als Richtlinienverfahren zur Behandlung von psychischen Störungen der heilkundlichen Berufe zu verstehen.
Eine Familientherapie gilt nicht als Verfahren zur Behandlung psychischer Störungen, sondern zur Veränderung interaktioneller Verhaltensmuster innerhalb von Familiensystemen, die eine Verbesserung der Beziehung zwischen Familienmitgliedern, sowie des Zusammenlebens erzielen möchte.
Zusätzlich ist es theoretisch auch möglich eine systemische Therapie zu beginnen und erfolgreich abzuschließen, ohne das Umfeld direkt mit einbeziehen zu müssen, da, je nach Alter der Patient*innen, auch durch ressourcenorientiertes Arbeiten an der Veränderung einer eigenen Grundhaltung gearbeitet wird, die sich wiederum (zirkulär) auf das Umfeld und die betreffende Person selbst auswirkt, wohingegen bei einer Familientherapie der Fokus klar auf der Einbeziehung der betreffenden Familienmitglieder liegt.
Die systemische Therapie ist in sofern sehr ähnlich, als dass sie auf den Grundprinzipien der Familientherapie aufbaut und diese mit bestehenden Modellen zur Behandlung psychischer Störungen anreichert und kombiniert.
In jedem Therapieverfahren der Psychotherapie bestehen unterschiedliche Erklärungsmodelle zur Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen, sowie Ansätze und Methoden zu deren Behandlung.
In der systemischen Therapie ist die Entstehung psychischer Störungen als Lösungsversuch eines Individuums innerhalb ihres Systems und Kontext in dem sie sich bewegt und lebt zu betrachten, so dass die Symptome als missglückter Lösungsversuch betrachtet und somit grundlegend gewertschätzt werden. Sie zeigen aus systemtherapeutischer Sicht Missstände auf und sorgen für eine „Störung im System“.
Die systemische Therapie probiert einen Nutzen in der bisherigen Symptomatik zu erkennen. Das „Wozu dient dieses Symptom?“ ist hier also vielmehr von Bedeutung als das „Warum ist das Symptom da?“ und bildet alleine durch diese Fragestellung einen wichtigen Unterschied zu anderen Verfahren. Dabei versuchen systemische Therapeut*innen Muster der betreffenden Person, die vorgestellt wird (die sogenannten Indexpatient*innen) zu erkennen, Muster der Personen, von denen die Indexpatien*innen betroffen sind zu analysieren und durch Beobachtung und Anamneseerhebung Rückschlüsse auf die Interaktionsdynamik und Muster in dieser Dynamik zu finden, die für die Entstehung und Aufrechterhaltung der Sympomatik verantwortlich scheinen. Durch eine Veränderung dieser Muster (Musterunterbrechung/Aufweichung/Veränderung/Verstörung) kommt es in der Regel auch zu einer Veränderung in der Interaktionsdynamik, was nun ermöglicht, neue, positiv bewertete Muster zu entwickeln und zu etablieren um eine Verbesserung der Lebensumstände und Lebensqualität zu bewirken, die auf Dauer die Reduktion der Symptomatik und des Leidensdrucks zur Folge haben soll. Dabei liegt der Schwerpunkt auf einem möglichst lösungs- und ressourcenorientiertem Arbeiten statt einem problem- und symptomorientiertem.
Mehr dazu:
Symptome sind in der systemischen Therapie nicht als bewusste Entscheidung zu verstehen, sondern eine Begleiterscheinung der Strategien zum (Über-)Leben in dem jeweiligen Kontext, in dem sie statt finden. Ob eine psychische Störung daraus werden kann, liegt dann unter anderem daran, auf welche Ressourcen dieses Individuum und auch der Kontext in dem es sich bewegt zurück greifen kann. Erzielt die Symptomatik also beispielsweise so viele positive Veränderungen, dass das äußere- (Schule, Arbeitgeber, Eltern, Geschwister, Freunde etc.) und innere System (die betroffene Person selbst) sich beispielsweise daran in veränderter und positiv bewerteter Weise anpasst, wird sie als sinnvoll erlebt und kann als bestandene Entwicklungskrise bewertet und „abgehakt“ werden. Scheitert die Verbesserung der Interaktionsdynamik und die Verbesserung dessen, was gewünscht ist, entsteht auf Dauer Stress und in der Regel ein gewisser Leidensdruck für die betroffene Person selbst und/oder das Umfeld in dem sie lebt, so dass sich hierdurch eine psychische Störung entwickeln kann, die sich bei längerem Bestehen ohne Verbesserung, chronifizieren kann. In der Regel suchen Menschen eine Psychotherapie auf, wenn eigene Lösungsansätze zur Veränderung dysfunktionaler Muster (in dem Kontext nicht sinnvolle, eventuell sogar verschlimmernde Muster) gescheitert sind und es eine fachkundige Person zur Veränderung benötigt. So wird auch mit Ihrer Betitelung bereits ein wichtiger Unterschied gebildet. In der systemischen Therapie spricht man nicht von Patienten sondern von Klienten. Während gerade in der Medizin, die zu behandelnde Person als Patient (aus dem lateinischen übersetzt „der Geduldige“) bezeichnet wird, steht in der systemischen Therapie das aktive Mitwirken im Vordergrund, der eigene Wunsch nach Veränderung und somit die Veränderung zum Kunden, in der die Psychotherapeut*innen als Dienstleister gesehen werden, die mit Ihnen gemeinsam Ihre Wünsche und Ziele realisieren.
Psychotherapeut*innen sind keine (medizinischen) Ärzt*innen. Sie haben jedoch seit 1998 sozialrechtlich den Status als Fachärzt*innen wodurch auch die Psychotherapie an sich als fachärztliche Leistung gilt, die eine mehrjährige (mindestens 3 jährige in Vollzeit und mindestens 5 jährige in Teilzeit) Ausbildung erfordert, die nach dem Abschluss eines Psychologie-, und/oder für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen auch Pädagogik-, oder Sozialpädagogikstudiums mit Diplom oder eines Masterstudienganges begonnen werden darf, womit die Ausbildungsdauer mindestens 8-10 Jahre erfordert. Die psychotherapeutische Ausbildung endet mit der staatlichen Anerkennung, sowie der Möglichkeit auf die Approbation und dem Arztregistereintrag, der nochmal den Fachärzt*innenstatus und die Gleichstellung mit den medizinischen Kolleg*innen verdeutlicht.
Die Praxis




Leistungen
Was Sie bei mir in der Diagnostik und systemischen Therapie erwartet
- Diagnostik
- Systemische (Psycho-)Therapie
- Was wird psychotherapeutisch behandelt?
- Systemische Familientherapie
- Systemische Paartherapie
- Systemisches Coaching
Seit Januar 2025 biete ich nebst den verschiedenen Therapien und Coachings auch eine ausführliche Diagnostik für verschiedenste Störungsbilder, sowie eine allgemeine Leistungsdiagnostik (Intelligenztestung) an. Letztere ist für viele störungsspezifische Testergebnisse zum Abgleich notwendig, weswegen diese in der Regel zusätzlich zu den störungsspezifischen Testungen erfolgt.
Leistungsdiagnostik (Intelligenztestung):
WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for Children 5. Auflage):
Mit der WISC-V liegt ein sehr differenziertes Intelligenzdiagnostikum mit 15 Untertests für die Zielgruppe 6;00 – 16;11 (Jahre; Monate) vor, auf deren Basis sich folgende fünf Kennwerte bilden lassen:
- Arbeitsgedächtnis
- Sprachverständnis
- Verarbeitungsgeschwindigkeit
- visuell-räumliches Denken
- Fluides Schlussfolgern
- Gesamt-IQ Wert
Diese Differenzierung ermöglicht eine fundierte Einschätzung des Entwicklungsstandes. Weitere Analysen können auf der Untertestebene vorgenommen werden. So gelingt mit der Profilanalyse eine gezielte Aussage über Stärken und Schwächen eines Kindes. Zusätzlich liefern Prozessanalysen wertvolle Hinweise für eine fundierte Förderung.
Störungsspezifische Tests:
ADHS-Testung:
ADHS 6-12:
Das Verfahren wird als Einzeltest bei Kindern im Alter zwischen 6;0 und 12;11 Jahren angewandt. Ziel des ADHS-Tests 6–12 ist die Erhöhung der Sicherheit bei der Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit für das Vorliegen einer ADHS.
Dabei werden drei verschiedene Informationsquellen (Computertestung, Elternfragebogen, Lehrkraftfragebogen) zu einem Gesamtergebnis kombiniert. Die Computertestung erlaubt die objektive Erfassung der Inhibitionsfähigkeit. Der Elternfragebogen enthält 18 Fragen und dient der Erfassung der Kardinalsymptome von ADHS. Mit dem Lehrkraftfragebogen werden Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität mithilfe von drei globalen Einschätzungen erhoben. Der Lehrkraftfragebogen kann durch die Lehrkraft bzw. die primäre Bezugsperson in Bildungssettings ausgefüllt werden. Elternfragebogen und Lehrkraftfragebogen können über das Computerprogramm in der benötigten Stückzahl selbst ausgedruckt werden.
Das zum ADHS-Test 6–12 gehörende Computerprogramm erfüllt drei Aufgaben: Neben der Computertestung der Inhibitionsfähigkeit dient es der automatisierten Auswertung und der Datenhaltung. Für die Auswertung werden die Eltern- und Lehrkraftdaten in das Computerprogramm eingegeben. Das Computerprogramm ermittelt automatisch einen geschlechtsspezifischen Gesamtwert (T-Wert inkl. Konfidenzintervall und Prozentrang). Das Gesamtergebnis wird zur Ermittlung eines möglichen Verdachts auf ADHS herangezogen. Zusätzlich wird die geschlechtsspezifische Auftretenshäufigkeit des erzielten T-Wertes bei Kindern mit bzw. ohne ADHS angegeben.
Autismusspektrumstörungen (ASS):
Autismusspektrumstörungen werden in meiner Praxis in Zusammenarbeit mit einem Psychotherapeutischem Kollegen erhoben, der auch die Testung selbst durchführt.
Dabei testen wir derzeit in der Altersgruppe zwischen 7-12 Jahren (MODUL 3 des ADOS-2). Jüngere und Ältere Zielgruppen werden dem Testrepertoire in den nächsten Monaten hinzugefügt.
ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised):
Seit geraumer Zeit gilt das umfangreiche Diagnostische Interview für Autismus – Revidiert (ADI-R) in Klinik und Forschung als standardisiertes Befragungsinstrument erster Wahl zur Erfassung und Differenzialdiagnostik von Störungen des autistischen Spektrums. Das ADI-R eignet sich sowohl zur psychiatrischen Statusdiagnostik als auch zur Interventionsplanung. Es beinhaltet 93 Items zur frühkindlichen Entwicklung, zu Spracherwerb und möglichem Verlust von sprachlichen Fertigkeiten, verbalen und nonverbalen kommunikativen Fähigkeiten, Spiel- und sozialem Interaktionsverhalten, stereotypen Interessen und Aktivitäten sowie komorbiden Symptomen (Aggression, Selbstverletzung, Epilepsie). Informanten sind in der Regel die Eltern oder seltener andere Bezugspersonen, die mit der Entwicklung und aktuellen Symptomatik des Probanden sehr gut vertraut sind. Die Auswertung und Interpretation der Ergebnisse erfolgt über die Verrechnung einer Auswahl von Items in einem empirisch generierten diagnostischen Algorithmus, der sich streng an den Richtlinien zur klinischen Klassifikation nach ICD-10 und DSMIV- TR orientiert.
ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule – 2. Auflage):
ADOS-2 ist ein zuverlässiges, valides und klinisch sehr anschauliches Verfahren zur Abklärung und Klassifikation von qualitativen Auffälligkeiten der sozialen Interaktion und reziproken Kommunikation im Sinne einer autistischen Störung. Die strukturierte Ratingskala verfügt über reichhaltiges Untersuchungsmaterial und gehört zum internationalen Standard der Diagnostik von Störungen des autistischen Spektrums. Je nach Alter und Sprachniveau der zu testenden Person wird eine von fünf Untersuchungsstrategien (Module) gewählt. Mithilfe gezielt inszenierter spielerischer Elemente, Aktivitäten und Gespräche können Sachverhalte und Symptome, die für die Diagnose einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) relevant sind, geprüft werden.
ADOS-2 wird eingesetzt, um Kommunikation, soziale Interaktion und Spielverhalten von Menschen (Kindern wie Erwachsenen) zu erfassen, bei denen eine Autismus-Spektrum-Störung (ASS) vermutet wird.
Das Verfahren besteht aus fünf Modulen:
- Kleinkind-Modul: für Kleinkinder im Alter von 12 bis 30 Monaten, die nicht durchgehend Sätze benutzen
- Modul 1: für Kinder ab einem Alter von 31 Monaten, die nicht durchgehend Sätze benutzen
- Modul 2: für Kinder in jedem Alter, die durchgehend Sätze benutzen, aber noch nicht fließend sprechen
- Modul 3: für fließend sprechende Kinder und junge Jugendliche
- Modul 4: für fließend sprechende ältere Jugendliche und Erwachsene
Teilleistungsstörungen der schulischen Fertigkeiten:
Die Testungen der Teilleistungsstörungen der schulischen Fertigkeiten umfassen bei mir die sogenannte Rechenschwäche (Dyskalkulie), die Lese- und Rechtschreibstörung (LRS), sowie die isolierte Rechtschreibstörung.
Dyskalkulie:
ERT JE (Eggenberger Rechentest für Jugendliche und Erwachsene):
Das Verfahren eignet sich speziell zur Erkennung von Rechenschwäche/Dyskalkulie für den die 7. und 8. Klassenstufe. Es kann als Gruppentest sowie als Einzeldiagnostikum angewandt werden. Neben der Diagnostik von Rechenschwäche/Dyskalkulie gibt der ERT JE zusätzlich Aufschluss über das konkrete Ausmaß einer solchen Störung. Überdies lassen sich aus den Testergebnissen erste Förderschwerpunkte ableiten. Prozessdiagnostisch können anhand des ERT JE Veränderungen durch gezielte Förderung überprüft und nachgewiesen werden.
Lese- und Rechtschreibstörungen:
ELFE-II (Ein Leseverständnistest für Erst-Siebtklässler Version II 5. Auflage):
ELFE II erfasst die Leseverständnisleistung, die Leseflüssigkeit und die Lesegenauigkeit auf der Wort-, Satz- und Textebene. Die Subtestergebnisse werden zu einem Gesamtergebnis verrechnet. Zusätzlich ermöglicht das Verfahren verschiedene differenzielle Auswertungen (auffällige Diskrepanzen zwischen Untertests, Analyse des Arbeitsstils). ELFE II ist als Computer- oder Papierform anwendbar.
ELFE II stellt die Weiterentwicklung und umfassende Neunormierung des Verfahrens ELFE 1-6 dar. Im Vergleich zu ELFE 1-6 wurden mehrere Neuerungen vorgenommen. Dazu gehören u.a. zwei Kurzversionen für die Klassen 1–3 bzw. 4–7. Die Anzahl der Items für jeden Subtest wurde gegenüber der Vorgängerversion erhöht, was eine noch bessere Differenzierung über das gesamte Leistungsspektrum erlaubt.
Die Normierungsmethode ermöglicht die verlässliche Zuordnung von Normwerten zur erfassten Testleistung zu jedem beliebigen Zeitpunkt des Schuljahres.
SLRT-II (Salzburger Lese- und Rechtschreibtest – 2. Version):
Ein-Minuten-Leseflüssigkeitstest: 1. bis 6. Klasse und Erwachsene. Rechtschreibtest: 1. bis Anfang 5. Klasse. Der SLRT-II ist ein Verfahren zur differenzierten Diagnose von Schwächen des Schriftspracherwerbs. Er erlaubt die Beurteilung von Teilkomponenten des Lesens und Rechtschreibens und stellt somit auch die Basis für die Erstellung detaillierter Förderpläne dar. Diese wesentliche diagnostische Differenzierung basiert auf aktuellen Ergebnissen der kognitions- und neuropsychologischen Leseerwerbsforschung. Der Ein-Minuten-Leseflüssigkeitstest erfordert das laute Vorlesen von Wörtern bzw. Pseudowörtern innerhalb der auf eine Minute beschränkten Lesezeit und ist nur als Individualtest durchführbar. Er ermöglicht eine separate Diagnose zweier wesentlicher Teilkomponenten des Wortlesens: Defizite in der automatischen, direkten Worterkennung und Defizite des synthetischen, lautierenden Lesens. Der Ein-Minuten-Leseflüssigkeitstest differenziert sowohl im unteren, als auch im mittleren und oberen Leistungsbereich. Die Beurteilung der Leseleistung ist von der 1. Schulstufe bis ins Erwachsenenalter möglich.
Der Rechtschreibtest erhebt die Kompetenz, diktierte Wortschreibungen orthographisch korrekt in Rahmensätze einzufügen und kann als Einzel- oder Klassentest durchgeführt werden. Der Rechtschreibtest erlaubt die getrennte Beurteilung von Schwächen in der lauttreuen Schreibung und Schwächen in der orthographisch korrekten Schreibung. Zusätzlich wird die Groß- und Kleinschreibung als eigene Fehlerkategorie berücksichtigt. Er ist insbesondere bei Kindern angezeigt, die in Bezug auf die Rechtschreibleistung bereits auffällig geworden sind, so dass der Verdacht einer Lernstörung in diesem Bereich besteht. Sowohl für den Lese- als auch für den Rechtschreibtest liegen Parallelversionen vor. In der 2. Auflage liegen neu auch für die 1. Schulstufe Normen für den Rechtschreibtest vor. Zusätzlich werden für den Rechtschreibtest vom 1. bis Anfang 5. Schuljahr Schweizer Normen angeboten.
Nachdem Sie sich für eine systemische Therapie entschieden haben muss die Finanzierung dieser mit der jeweiligen Krankenkasse (auch Private) oder Kostenbeihilfestelle geklärt werden. Ausnahme betrifft selbstzahlendes Klientel (Detaillierter im Punkt Finanzierung beschrieben).
Schreiben Sie mir eine Email mit Ihrer Anfrage und einer kurzen Beschreibung ihres Anliegens. Ich versuche diese immer so zeitnahe wie möglich zu beantworten, auch bei einer Absage und/oder Weiterverweisung an Kolleg*innen.
Wenn ich auf Grund der Anfrage der fachlichen Meinung bin, dass eine systemische Therapie indiziert ist oder bereits eine Indikation hierfür vorliegt, werde ich Sie zu einem gemeinsamen Kennenlerngespräch einladen. Hiermit beginnt die sogenannte probatorische Phase in der Sie und ich 2-6 Sitzungen Zeit haben uns kennen zu lernen und beidseitig zu entscheiden, ob eine Behandlung zu Stande kommt (für Privatversicherte besteht keine probatorische Phase, sondern es geht ab der 1. Sitzung offiziell los).
Sollte hieraufhin eine Therapie zu Stande kommen, kann diese bei selbstzahlendem- oder privatversichertem Klientel nahtlos weiter laufen. Bei Klienten aus der Kostenerstattung- und Kostenbeihilfe muss hieraufhin erst ein Antrag bei der Krankenkasse und/oder der Kostenbeihilfe auf Kurzzeittherapie oder Langzeittherapie gestellt werden.
Für die Psychotherapie werden Behandlungsziele definiert und auch immer wieder im Rahmen der Qualitätssicherung und des Behandlungsprozesses überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Eine systemische Therapie, bei der ein Antrag für eine Kurzzeittherapie gestellt wurde, besteht aus 12 (KZT-I) oder bis zu 24 (KZT-II) wöchentlichen Sitzungen zu je 50 Minuten oder bis zu 36 wöchentlichen Sitzungen mit Aussicht auf Verlängerung auf 48 Sitzungen bei einer Langzeittherapie. Analoge Zeiträume, ohne Antrag gelten jedoch auch für Privatversicherte und Selbstzahlende.
Sollten die zur Beginn der Therapie vereinbarten oder im Laufe der Therapie veränderten Ziele erreicht sein, endet die Therapie mit einem gemeinsamen Abschlussgespräch aller Beteiligten, die eine Rückschau des Therapieverlaufes, sowie das gemeinsame Zelebrieren der erreichten Erfolge beinhaltet.
Mehr dazu:
Bereits während des Kennenlerngespräches findet der erste Schritt zur systemischen Diagnostik statt. Neben der Erhebung Ihres Anlasses, Anliegens, des Auftrages und eines möglichen Kontraktes (AAA-K Regel) werden bereits erste Interaktions- und , Verhaltens-, – Emotions- und Denkmuster beobachtet und analysiert. Hierzu ist es gewinnbringend für alle, wenn bereits beide Elternteile, sofern vorhanden, sowie auch das betreffende Kind anwesend sind. Sollte es zu einer Einigung und einem entsprechenden Therapiekontrakt kommen, der über das Kennenlernen hinausgeht, werden im nächsten Schritt Folgetermine vereinbart in denen unterschiedliche Personensettings eingeladen werden.
Dabei werden während der gesamten Therapie ab dem Zeitpunkt des Kennenlernen, sogenannte Hypothesen durch mich aufgestellt in denen ich auf Grund beobachteter Situationen und daraus gebildeten Mustern, versuche mögliche Veränderungsideen zu generieren, die dann durch entsprechende Folgeinterventionen, mit Ihnen und durch Sie, umgesetzt werden. Dies bedeutet beispielsweise, dass es auch Termine geben kann, bei denen auch Geschwisterkinder, Freund*innen ihres Kindes, nur Sie als Eltern, einzeln oder zusammen, nur die Betreffenden Indexpatient*innen usw. anwesend sind. Durch diese Konstellationsveränderungen (Settingwechsel) wird es mir möglich unterschiedliche Interaktionsmuster zu erkennen und Interventionen hierhin-gehend anzupassen. Im Vergleich zur gerade im Ruhrgebiet etwas bekannteren und deutlich häufiger verfügbaren Verhaltenstherapie, besteht für die meisten Störungen kein störungsspezifischer „Muster-“ Behandlungsplan. Stattdessen werden gemeinsam hypothesengeleitete Interventionen erstellt, die auf den theoretischen Grundprinzipien der Interaktionsveränderung und Beziehungsverbesserung, sowie der Aktivierung bereits vorhandener Ressourcen oder Anreicherung neuer Ressourcen bestehen und somit bei jeder Person individuell nach deren notwendigen Veränderungsansätzen geschaut. Eine klassische Schablonierung entfällt somit weitestgehend. Auch hier bilden Ausnahmen die Regel. Im systemischen Verständnis sind Sie somit die Expert*innen für Ihre Bedürfnisse und nicht ich als Psychotherapeut. Zusätzlich werden zu Beginn der Therapie Ziele mit allen betreffenden Personen für alle betroffenen Personen erstellt, die sowohl die Eltern-, die Paar- (falls vorhanden), die Familien- und die Eltern-Kindebene, jedoch auch die Individualebene jeder einzelnen Person betreffen, die in die Therapie mit einbezogen wird.
Passende Ziele zu finden und diese auch immer wieder zu reflektieren und bei Bedarf anzupassen sind großer Bestandteil der systemischen Interventionen und dienen, wie bereits beschrieben auch der Qualitätssicherung.
Systemische Therapie ist für alle psychischen Störungen (F-Diagnosen nach ICD10) zur Behandlung bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen geeignet.
Darunter zählen beispielsweise:
- Alle möglichen Formen von ausgeprägten Ängsten
- Aufmerksamkeitsdefizit (Hyperaktivitäts-)störung (AD(H)S)
- Affektive Störungen, wie Depressionen
- Ticstörungen
- Zwangsgedanken und Zwangshandlungen
- Essstörungen wie Anorexie, Bulimie und Binge-eating
- psychosomatische Beschwerden wie Bauchschmerzen, Kopfschmerzen und Schwindel
- Panikattacken
- Posttraumatische Belastungsstörungen (z.B. durch ein (lebens-)bedrohliches Ereignis)
- Störungen des Sozialverhaltens, aggressives und/oder dissoziales Verhalten
- Schlafstörungen, wie Einschlaf- und Durchschlafstörungen, Albträume etc.
- Störungen sozialer Funktionen
Zusätzlich ist systemische Therapie das einzige anerkannte Verfahren, bei dem auch explizit die sogenannten Z-Diagnosen (psychosozialen Diagnosen) als Schwerpunkt behandelt werden und bei den Diagnosen, neben den F-Diagnosen, ebenfalls immer mit vergeben werden.
Hierzu zählen beispielsweise:
- Mobbing
- Interaktionsstörung Eltern-Kind
- Erziehungsschwierigkeiten
- Geschwisterrivalitäten
- Scheidungskindsituationen durch Trennung der Eltern
- Familienzerrüttung durch Tod oder Trennung
- Anhaltende Paarkonflikte
- uvm.
Familientherapie wird, im Vergleich zur systemischen Therapie, nicht zur Behandlung psychischer Störungen angewendet, sondern lediglich zur Verbesserung interaktioneller Verhaltens- und Beziehungsmuster und -dynamiken, sowie den damit zusammenhängenden zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie liefert somit einen wichtigen Schutz zur Prävention von psychischen Störungen, die durch das zwischenmenschliche Zusammenleben entstehen können.
Eine Familientherapie bei mir verläuft sehr ähnlich zur systemischen Therapie, nur dass sich diese primär auf die Familie selbst richtet und nicht das erweiterte Umfeld mit einbezieht (z.B. Schule, Verein, etc.) und keine psychische Störung hiermit behandelt wird.
Familientherapeutische Sitzungen können als Einzel- (50-60Minuten) oder Doppelstunde (100-120 Minuten) wahrgenommen werden. Je nach Zielen und Auftragsstellung können Tonus und anwesende Personen variieren. Zwischen den Sitzungen können somit nur einige Tage oder mehrere Wochen liegen. Dies wird gemeinsam mit Ihnen besprochen und eine sinnvolle Frequenz zur Erreichung ihrer Ziele nach Bedarf angepasst.
Auch für die Familientherapie findet ein Abschlussgespräch statt bei dem die erreichten Ziele gemeinsam zelebriert und die Therapie damit offiziell beendet wird.
Mehr dazu:
Familientherapie ist in Deutschland kein geschützter Begriff, so dass sich grundlegend jede ausübende Person Familientherapeut*in nennen und diesen Beruf ausüben darf. In der Regel sind Familientherapeut*innen ebenfalls in einer familientherapeutischen Ausbildung gewesen, die zwischen 1,5 und 3 Jahren dauert und können diese durch ein Qualitätssiegel ihrer Ausbildung belegen, wie beispielsweise das der Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung und Familientherapie e. V. (DGSF).
Familientherapie ist durch die Krankenkasse nur erstattungsfähig, wenn ein Elternteil oder die erwachsene Bezugsperson, bei der das Kind lebt, eine psychische Störung aufweist und sich dies auch auf die Gesundheit der in der Familie lebenden Personen auswirkt. Ohne Krankheitswert kann die Familientherapie nicht abgerechnet, jedoch als außerordentliche Belastung steuerlich angegeben werden. Sprechen Sie hierzu bitte ihre Krankenkasse und ggf. auch Kostenbeilhilfestelle selbst an und fragen Sie vorher, in welchem Rahmen eine Finanzierung möglich ist.
Ich bin nach DGSF Standards zertifizierter systemischer Familientherapeut und werde Ihnen in diesem Rahmen auch die entsprechende Qualität zukommen lassen.
Bei der systemischen Paartherapie finden dieselben Mechanismen systemischer Therapie statt, die im Teil systemische Therapie nachzulesen sind. Der Schwerpunkt liegt jedoch darin eine Klärung über die Paarbeziehungsebene herbei zu führen und funktionale (neue oder alte) Denk- und Verhaltensmuster zu etablieren, die sich wiederum auf die Emotionsebene auswirken. Im Vergleich zum weit verbreiteten Glauben, dass eine Paartherapie der „Rettung der Beziehung“ dienen soll, kann diese auch genutzt werden, um beispielsweise gemeinsam einen Weg aus der Beziehung zu finden oder sich klar gegen die Fortführung der Beziehung zu positionieren. Selbstverständlich jedoch auch, um die Paarbeziehung an sich wieder positiv zu etablieren und erleben zu können.
Eine systemische Paartherapie findet in der Regel als Doppelstunde mit 100-120 Minuten zu etwa 10 Sitzungen statt. Der Tonus kann hierbei variieren. Sitzungen werden im 2-4 Wochen Rhythmus geplant. Auch bei einer systemischen Paartherapie werden zu Beginn der Therapie gemeinsame Ziele festgelegt, die im Verlauf der Therapie reflektiert und ggf. angepasst werden. Für die „therapielose Zwischenzeit“ werden Hausaufgaben an die Paare vergeben, die dann gemeinsam in der Folgesitzung reflektiert und ggf. zielführend angepasst werden.
Zum Ende der Therapie findet ein Abschlussgespräch statt, bei dem der Prozess gemeinsam reflektiert und über ein Ende oder eine Fortsetzung der Therapie entschieden wird.
Mehr dazu:
Paartherapie und deren Ausübung sind keine geschützten Begriffe. Sie darf somit durch jede Person durchgeführt werden. Auch für die Paartherapie gibt es Qualitätssiegel, die einen Berufsausbildungsabschluss in diesem Bereich voraussetzen. Qualifizierte Paartherapeut*innen müssen ebenfalls eine Grundausbildung/Grundstudium im psychosozialen Bereich absolviert haben und legen hiernach in der Regel eine 1-2 jährige weiterbildende Berufsausbildung ab, die dann ebenfalls beispielsweise durch das DGSF Siegel zertifiziert wird. Ebenso wie bei der Familientherapie kann diese grundsätzlich nicht zur Behandlung psychischer Störungen verwendet werden und dient lediglich der Verbesserung interaktioneller Beziehungsdynamiken mit dem Schwerpunkt auf Paarbeziehungen erwachsener Menschen.
Auch die Paartherapie kann als außerordentliche Belastung steuerlich angegeben werden.
Sollte eine Person des zu behandelnden Paares eine psychische Störung aufweisen, ist in der Regel zusätzlich immer die Indikation für psychologische Psychotherapie mit einem geeigneten Verfahren der vier Vertiefungsgebiete zu klären.
Ich bin noch kein zertifizierter Paartherapeut, werde diese Weiterbildung jedoch berufsbegleitend noch abschließen. Da sowohl in der systemischen Therapie, als auch Paartherapie, die Arbeit mit Elternpaaren zum zentralen Teil der Arbeit gehören, überlappen sich hier sehr große Teile der Behandlungsart und Vorgehensweise, so dass ich seit 2014 auch regelmäßig in paartherapeutischen Settings agiere und Ihnen durch meine Erfahrung ebenfalls einen ansprechenden Service bieten kann.
Beim Coaching geht es um eine Verbesserung der Lebensqualität durch Veränderung der eigenen Haltung sich-selbst und seinen Mitmenschen gegenüber. Coaching ist vor allem lösungs- und ressourcenorientiert und wird für Personengruppen verwendet, die keinen therapeutischen Bedarf haben (Symptomatische Auffälligkeiten mit Störungscharakter), jedoch positiv etwas an ihrem Leben (z.B. beruflich, privat, in ihren Beziehungen, ihrem Auftreten, etc.) verändern wollen. Für das Coaching werden individuelle Ziele und ein Coachingplan mit Ihnen erstellt. Die Frequenz der Termine und die Dauer variieren von 50-60 Minuten wöchentlich zu 100-120 Minuten bei niedriger Terminfrequenz (mindestens 14 Tage Abstand zwischen den Terminen). Sie können das Coaching immer wieder bei Bedarf nutzen und bestimmen selbst Ihr Tempo und den Bedarf.
Finanzierung Psychotherapie
Seit dem 01.03.2025 habe ich eine kassenärztliche Niederlassung und kann nun auch gesetzlich versicherte Patient*innen/Klient*innen behandeln. Melden Sie sich für Anfragen bitte per Email bei mir. Bei freien Kapazitäten folgt eine erste Sprechstunde und bei psychotherapeutischer Indikation geht die probatorische Phase mit bis zu 6 Sitzungen los. Sollte ein gemeinsamer Behandlungsauftrag formuliert werden können wird hiernach ein Formantrag bei der Krankenkasse gestellt, die diesen i.d.R. zeitnahe bewilligt. Dies umfasst dann 12-24 Sitzungen. Die sogenannte Kurzzeittherapie- (I =12 , II = 24). Sollten mehr als 24 Sitzungen benötigt werden, kann eine Langzeittherapie beantragt werden, die bei der systemischen Therapie entweder bis zu 36 oder 48 Sitzungen umfasst. Hinzu kommen mögliche Stunden mit den Bezugspersonen und Akutterminen bei Krisen oder höherem Bedarf.
Wenn Sie privat versichert sind sollten Sie sich mit Ihrer privaten Krankenkasse in Verbindung setzen, in welchem Umfang die Kosten für eine Psychotherapie gedeckt werden. Für Privatpatienten existieren keine probatorischen Sitzungen, da hiernach kein Antrag auf eine Kurzzeittherapie gestellt wird und diese antragsfrei verläuft, so dass eine Therapie offiziell mit dem ersten gemeinsamen Termin zu Stande kommt. Ebenso wie bei den gesetzlich versicherten Patient*innen muss ein Antrag auf Langzeittherapie mit Einleitung einer gutachterlichen Prüfung gestellt werden. Dabei können entweder 36 oder 48 Sitzungen beantragt werden. Zudem kommen auch hier noch Bezugspersonenstunden und Akuttermine hinzu.
Manche privatversicherte Patient*innen haben zusätzlich ihre Versicherung über die Kostenbeihilfestelle abgedeckt. In der Regel sind dies verbeamtete Berufe. In diesem Falle müssen Sie mit Ihrer privaten Krankenkasse und Kostenbeihilfestelle die Kostenübernahme abklären.
In der Regel sind 12-24 Sitzungen abgedeckt. Sitzungen darüber hinaus benötigen eine schriftliche Stellungnahme an die Gutachter*innen in denen eine Langzeittherapie (ab 25 Sitzungen) begründet wird. Genauso wie bei der gesetzlichen Krankenkasse umfasst dies bei der systemischen Therapie 36 bis 48 Sitzungen mit Option auf Bezugspersonenstunden und Akutterminen bei erhöhtem Bedarf.
Sollten Sie gesetzlich versichert sein und haben eine private Zusatzversicherung abgeschlossen, die Psychotherapie abdeckt, sollten Sie unter den selben Bedingungen, die auch für privat versicherte Patienten gelten eine Psychotherapie in Anspruch nehmen können. Doch seien Sie vorsichtig. Ein nachträglicher Abschluss einer solchen Versicherung, wenn bereits eine Diagnose vorliegt, führt meistens zur Ablehnung der Aufnahme einer privaten Zusatzversicherung durch die Versicherung oder eine zeitnahe Kündigung ebendieser. Klären Sie auch bei privaten Zusatzversicherungen immer die Kostenzusage- und Übernahme vor dem Therapiebeginn ab.
Ggf. benötigen Sie hierfür einen Konsiliarbericht, der durch die weiterverweisenden Kinderärzt*innen/Hausärzt*innen oder Kinder- und Jugendpsychiater*innen oder durch mich ausgefüllt wird. Ggf. besteht durch einen Arztbrief bereits eine Indikation für Psychotherapie, den Sie Ihrer Krankenkasse vorlegen können.
Das einfachste Modell zur Aufnahme einer systemischen Psychotherapie ist das eigene Tragen des vollen Kostenumfangs. Hierbei findet keine Dreiecksbeziehung zwischen Krankenkassen/Kostenbeihilfestellen, Klienten und Therapeuten statt. Der gesamte Austausch und Klärung über den finanziellen und inhaltlichen Teil bleibt, alle Themen betreffend, zwischen Ihnen und dem Therapeuten. Ausnahmen bilden in der Zukunft statt findendes Fremd- und/oder Selbstgefährdendes, einschließlich suizidalen Verhaltens, was immer einen Bruch der Schweigepflicht zur Folge hat, da das Abwenden, von Leid für andere und sich Selbst hierbei Vorrecht vor der Schweigepflicht hat und somit beispielsweise die Polizei, Feuerwehr oder der Rettungsdienst informiert werden müssen.
Finanzierung Familientherapie
Das einfachste Modell zur Aufnahme einer systemischen Familientherapie ist das eigene Tragen des vollen Kostenumfangs. Hierbei findet keine Dreiecksbeziehung zwischen Krankenkassen/Kostenbeihilfestellen, Klienten und Therapeuten statt. Der gesamte Austausch und Klärung über den finanziellen und inhaltlichen Teil bleibt, alle Themen betreffend, zwischen Ihnen und dem Therapeuten. Ausnahmen bilden in der Zukunft statt findendes Fremd- und/oder Selbstgefährdendes, einschließlich suizidalen Verhaltens, was immer einen Bruch der Schweigepflicht zur Folge hat, da das Abwenden, von Leid für andere und sich Selbst hierbei Vorrecht vor der Schweigepflicht hat und somit beispielsweise die Polizei, Feuerwehr oder der Rettungsdienst informiert werden müssen.
Sie können Familientherapie, sollte kein Anspruch auf eine Kostenübernahme durch die Krankenkasse oder Jugendämter bestehen, in Ihrer Steuererklärung als außerordentliche Belastung angeben und hierdurch einen Teil der Kosten über die Steuererklärung decken.
Sowohl für privat als auch gesetzlich versicherte gilt: Familientherapie zählt nicht zur psychotherapeutischen Versorgung und wird somit nicht regulär durch die Krankenkassen bezahlt. Es gibt jedoch die Möglichkeit zur Kostenübernahme, wenn mindestens ein Elternteil eine psychische Störung diagnostiziert bekommen hat und die Störung des erwachsenen Elternteiles sich negativ auf die Gesundheit des/r im Haushalt lebenden Kindes/r auswirkt. Klären Sie in diesem Falle eine Kostenübernahme mit Ihrer Krankenkasse ab.
Finanzierung Paartherapie
Da Paartherapie nicht zur psychotherapeutischen Versorgung gehört, wird sie nicht durch die gesetzlichen oder privaten Krankenkassen übernommen. Paartherapie ist somit eine reine Selbstzahlenden Leistung. Sie können Paartherapie in Ihrer Steuererklärung als außerordentliche Belastung angeben und hierdurch einen Teil der Kosten über die Steuererklärung decken. Genauso wie für selbstzahlendes Klientel in der Psychotherapie und Familientherapie findet keine Dreiecksbeziehung zwischen Krankenkassen/Kostenbeihilfestellen, Klienten und Therapeuten statt. Der gesamte Austausch und Klärung über den finanziellen und inhaltlichen Teil bleibt, alle Themen betreffend, zwischen Ihnen und dem Therapeuten. Ausnahmen bilden in der Zukunft statt findendes Fremd- und/oder Selbstgefährdendes, einschließlich suizidalen Verhaltens, was immer einen Bruch der Schweigepflicht zur Folge hat, da das Abwenden, von Leid für andere und sich Selbst hierbei Vorrecht vor der Schweigepflicht hat und somit beispielsweise die Polizei, Feuerwehr oder der Rettungsdienst informiert werden müssen.
Finanzierung Coaching
Coaching ist eine reine Selbstzahlenden Leistung. Sie gehört nicht zur psychotherapeutischen Gesundheitsversorgung und ist somit weder bei den Krankenkassen/Kostenbeihilfestellen oder Jugendämtern finanzierungsfähig.
Genauso wie für selbstzahlendes Klientel in der Psychotherapie, Familientherapie und Paartherapie findet keine Dreiecksbeziehung zwischen Krankenkassen/Kostenbeihilfestellen, Jugendämtern, Klienten und Therapeuten statt. Der gesamte Austausch und Klärung über den finanziellen und inhaltlichen Teil bleibt, alle Themen betreffend, zwischen Ihnen und dem Therapeuten. Ausnahmen bilden in der Zukunft statt findendes Fremd- und/oder Selbstgefährdendes, einschließlich suizidalen Verhaltens, was immer einen Bruch der Schweigepflicht zur Folge hat, da das Abwenden, von Leid für andere und sich Selbst hierbei Vorrecht vor der Schweigepflicht hat und somit beispielsweise die Polizei, Feuerwehr oder der Rettungsdienst informiert werden müssen.
Kontakt
Dominic Tobias Schmidt
Diplom-Sozialpädagoge
Systemischer Familientherapeut (DGSF)
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut im Vertiefungsgebiet systemische Therapie
Witteringstr. 97
45130 Essen
0176 4898 2895
kontakt@dtschmidt-spt-kjp.de